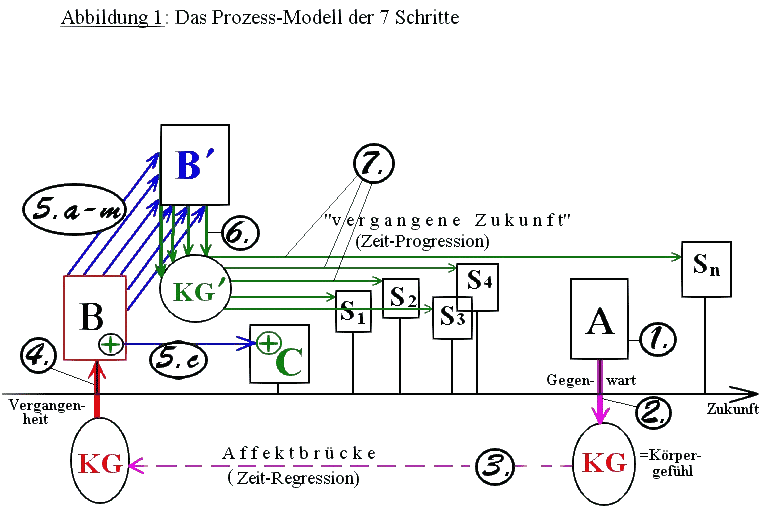Psychotherapie bei traumatischen Erlebnissen
von Dr. Wolfram Dorrmann, Bamberg
Inhalt:
- Einführung in den vorliegenden Text
- Allgemeine Hinweise zur Arbeit mit Regression und Trance
Indikation - Kontraindikation - Setting
- Die 7 Schritte der Identifikation und Bearbeitung traumatischer
Erlebnisse
Abbildung 1: Das Prozess-Modell der 7 Schritte
- Die Fragwürdigkeit von erinnerten Traumata
Das False-Memory-Syndrom (FMS)
- Konkrete Techniken für die Umsetzung der 7 Schritte
Detaillierte Beschreibung der einzelnen Techniken zur
hypnotherapeutischen Traumabearbeitung
Schritt 1-4 |
Schritt 5 | Schritt 6-7
- Ergänzende Interventionstechniken für Problemsituationen
Verpackungstechniken - Veränderungstechniken
- Anhang: Zitierte und weiterführende Literatur sowie
Links zum Thema: Arbeit mit Regression & Trance
A: Einführung
Wenn die aktuellen Probleme von Klienten sehr eng mit traumatischen
Phasen ihrer Lebensgeschichte verknüpft sind, ist man meist an die Grenzen
rein verbaler oder verhaltensorientierter Interventionen angelangt. Wenn
Worte nicht mehr reichen, müssen andere Veränderungsmöglichkeiten genutzt
werden. Im folgenden Konzept werden ausschließlich solche Strategien und
Techniken zur Aufarbeitung traumatischer Erfahrungen dargestellt, welche
über innere Bilder und hypnotische Zustände zu Veränderungen im
psychischen und körperlichen Erleben des Patienten führen.
Diese Methoden sind abgeleitet aus der Hypnotherapie, Hypnoanalyse, der
Transaktionsanalyse und dem NLP (Altersregression, Affektbrücken,
hypnoprojektive Techniken, Dissoziation, Parenting, Reparenting, versch.
Ich-Zustände, Zeitlinien, Zeitprogression, Submodalitäten u.v.a.). Sie
werden, soweit dies über einen Text überhaupt möglich ist, detailliert
dargestellt und in ein allgemeines 7-stufiges Interventionsschema
integriert. Die Ursprünge dieses Schemas gehen zurück auf Dipl.-Psych.
Ortwin Meiss (Hamburg) und Dipl.-Psych. Manfred Prior (Frankfurt), die
beide das Milton-Erickson-Institut in Hamburg leiten.
Leider ist es nicht möglich, diese Methode alleine durch die hier
angebotenen Texte zu erlernen. Psychotherapeuten jedoch, die Erfahrung mit
der Bearbeitung traumatischer Erlebnisse haben oder über eine Ausbildung
in klinischer Hypnose verfügen, werden diese Seiten - nach meiner
Einschätzung - mit großem Gewinn für die eigene Arbeit lesen. Die
vorliegenden Texte gründen auf den Arbeitspapieren eines Seminars zu
diesem Thema, das ich in den letzten Jahren sehr häufig abgehalten habe.
|
"Außer ein paar handfesten Lebensregeln
sind gute Erinnerungen das Beste,
was man Kindern mitgeben kann"
(Sidney J. Harris) |
Wenn Sie ein solches Seminar in Ihrer
Institution abhalten möchten, klicken Sie es an, Sie erhalten dann nähere
Informationen dazu.
Wenn Sie sich nur für Hypnose und Hypnotherapie interessieren, finden
Sie einen interessanten und sehr ausführlichen Artikel von Prof. Dirk
Revenstorf auf der Homepage der Milton Erickson Gesellschaft für Klinische
Hypnose e.V. (M.E.G.):
http://www.milton-erickson-gesellschaft.de
B: Allgemeine Hinweise zur Arbeit mit Regression
und Trance
Indikation - Kontraindikation - Setting
1. Indikation:
Die Anwendungsmöglichkeiten dieser Methode ist sehr weit gefaßt. Sie
kann für ganz akut und schwer traumatisierte Patienten eingesetzt werden
aber auch bei lang vergangenen traumatischen Ereignissen oder Lebensphasen
(sog. "komplexe posttraumatische Belastungsstörung"; nach J.L.Herman,
1993) bis hin zu harmloseren ungünstig assimilierten Kindheitserfahrungen
Anwendung finden.
a) Bei bewussten Traumata: Wenn unverarbeitete traumatische
Ereignisse die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten und Lernprozesse
offensichtlich behindert haben oder eine an der aktuellen Situation
ansetzende Therapie behindern.
- Menschen die sexuelle Übergriffe, Gewalt/Folter oder schwere Unfälle
erleben mußten.
- Nachholen von Trauer: Verabschiedung von Eltern oder (Ex-)Partnern,
oder nahestehenden verstorbenen Personen.
b) Bei Hinweisen auf unbewusste Traumata: z.B.
- Ptn, die bei kleinen Störungen oder Konflikten zu unangemessenen
Schreckreaktionen, Gekränktsein, extremer Eifersucht etc. neigen.
- Normalerweise friedliche Menschen, die aber manchmal sogar durch
Kleinigkeiten so gereizt werden können, daß sie sich selbst nicht
wiedererkennen.
- Sozial kompetente Klienten, die aber manchmal doch Situationen
erleben, bei denen sie hinterher den Eindruck haben, sie standen
daneben, waren nicht sie selbst, es fehlten ihnen die Worte, fühlten
sich wie gelähmt.
- Ptn die unter Alpträumen oder unter unklaren Durchschlafstörungen
leiden.
- Bei chronischen Schmerzen, die mit einem "schmerzvollen" psychischen
Erlebnis in Verbindung stehen können.
- Wenn die Therapie trotz guter Motivation und guter Beziehung zum Th.
stagniert oder der Th Widerstand beim Pt vermutet.
c) In Kombination mit hypnoanalytischen Verfahren (nach Eisen &
Fromm, 1983 bzw. Copeland, 1986) bei Störungen in der Entwicklung von
Selbst- und Objekt-Repräsentanzen (Ptn mit sog. frühen Störungen;
Borderline bzw. Ptn mit posttraumatischer Belastungsstörung)
2. Kontraindikation:
- Psychose
- Wenn es zur eigenen Identität gehört, ein Trauma zu haben (sek.
Gewinn?!)
- In einer akuten Krise (Trennung, Suizidtendenzen)
- Vor einer problematischen Situation (Prüfungen etc.)
- Wenn die Erwartungen zu hoch sind (Alle Probleme sollen dadurch
gelöst werden)
- Wenn die aktuelle Problemsituation immer diesselbe ist oder ganz
klar umrissen werden kann (z.B. Prüfungsangst)
- Angehörige od. Partner meinen, der Pt sollte "seine Kindheit
verarbeiten"
3. Setting:
- Ausreichend lange und gute Beziehung zum Therapeuten (mehr als 5
Sitzungen)
- Störquellen, wie Telefon oder andere mögliche signifikante Reize
wenn möglich ausschalten.
- Genügend Zeit zum Durcharbeiten des Erlebnisses zur Verfügung haben
(mind. 30 Min.). Man sollte also nie mit einem solchen Prozeß beginnen,
wenn die Hälfte der Sitzung schon vorbei ist.
- Bei extremen Traumatisierungen eine angemessene Anzahl (> 10) von
weiteren kontinuierlichen Sitzungen (= nicht vor einem Urlaub damit
beginnen). Manchmal sind auch mehr als eine Sitzung pro Woche notwendig.
- Sitzhaltung: So nah, daß man die physiologischen Abläufe beim
Klienten gut wahrnehmen kann und so, daß die normale Blickrichtung des
Klienten etwas abgewandt ist (also nicht direkt gegenüber).
- Papiertaschentücher
C: Die sieben Schritte der Identifikation und
Bearbeitung traumatischer Erlebnisse
Die folgenden sieben Schritte können in der Regel innerhalb einer
Sitzung mit dem Klienten durchlaufen werden. Sie werden hier zunächst nur
ganz grob beschrieben und danach im Text nochmal einzeln im Detail
ausgeführt.
- Laß deinen Klienten (bzw.Übungspartner) ein Erlebnis aus der
jüngeren Vergangenheit finden, wo er sich "klein" und oder der Situation
im Verhalten nicht angemessen gefühlt hat (= Spontanregression bzw.
Problemtrance).
- Etabliere dann bei deinem Klienten durch geeignete Fragen ein
inneres Bild von dieser Situation und orientiere seine Wahrnehmung auf
die dazugehörigen Gefühle und entsprechenden körperlichen Reaktionen.
- Laß ihn dann mit diesem Gefühl innerlich zu dem Ereignis
zurückgehen, wo dieses Gefühl zum erstenmal in seinem Leben aufgetreten
ist.
- Ist er dort angekommen, so hilf deinem Kl. durch Fragen, die
relevanten Aspekte des Erlebnisses auf allen Wahrnehmungskanälen mit
entsprechenden Submodalitäten zu erinnern.
- Nun sind verschiedene therapeutische Strategien / Techniken möglich:
a) Therapeutische Stellungnahme zum Problem der Schuld bzw.
Verantwortlichkeit der Personen in der konkreten Situation
b) Dissoziation des Erlebnisses zur Schaffung von innerer Distanz.
c) Herausstellen einer mit dem Erlebnis assoziierten wichtigen
Erkenntnis oder eines sinnvollen positiven Lerneffektes und
Neuassoziation mit einer anderen Erinnerung.
d) Die hinter den vordergründigen Gefühlen stehenden Gefühle oder
Bedürfnisse entdecken lassen (oft Wut und/oder Trauer).
e) Bewertung des Geschehens aus der Sicht des erwachsenen Klienten oder
von möglichen wohlgesinnten Bezugspersonen.
f) Neuerleben der Situation durch Einbeziehen dieser unterstützenden
oder beschützenden Person (= Reparenting).
g) Dem "Kind" in der Situation Geschichten erzählen, oder ihm
klarmachen, daß mit diesem Ereignis "das Leben nicht zu Ende ist", wie
es vielleicht annimmt.
h) Der Situation eine Lebensgeschichte zugrundelegen, welche die
Entwicklung von Eigenschaften ermöglichte, mit einer solchen Situation
optimal umzugehen (Change history).
i) Bisherige Lösungen u. -versuche herausstellen und positiv
konnotieren.
j) Lösungen, die vom Klienten in anderen Bereichen entwickelt wurden,
auf die traumatische Situation übertragen lassen (= Resourcen nutzen).
k) Die Zielrichtung des Verantwortlichen in Frage stellen od. seine
Defizite herausarbeiten. Was hätte er an Wissen oder Erfahrungen haben
müssen, damit er sich besser verhalten hätte?. Situation mit der
"therapierten" Person vorstellen lassen, die diese wichtigen Erfahrungen
gemacht hat (= Parenting).
l) Das Problemverhalten in einen anderen Rahmen stellen
m) Submodalitäten erfragen und verändern lassen (evtl. auch ergänzend!).
- Bei bzw. nach jeder einzelnen Intervention den Kl. assoziieren
lassen und auf die entsprechenden Wirkungen wie veränderte
Körpergefühle, Glaubenssätze oder Submodalitäten fokussieren lassen, um
diese Veränderungen noch zu stabilisieren!
- Mit dem Gefühl die "vergangene" und weitere Zukunft betrachten und
neu erleben.
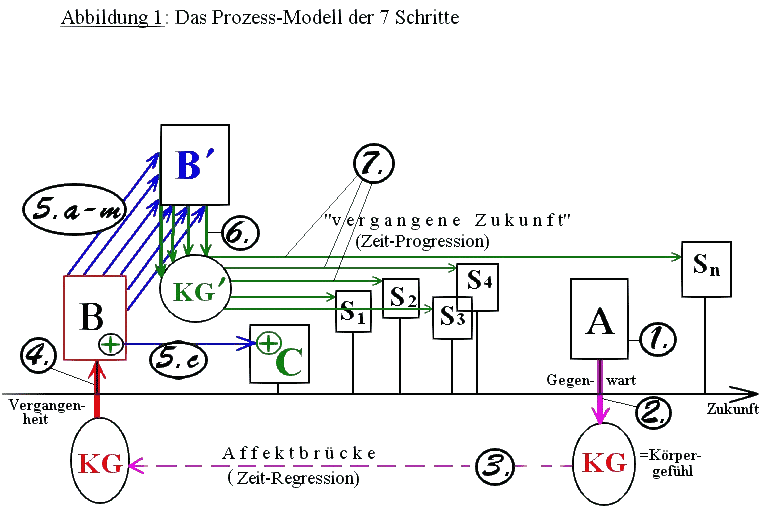
| A |
Situation, in der die unangemessenen Körpergefühle
auftreten |
| KG |
unangemessene Körpergefühle |
| B |
Situation in der Vergangenheit, die mit der
gegenwärtigen Situation in Verbindung steht
(Trauma, traumatische Lebensphase, ungünstig assimilierte Erf.) |
| + |
der positive Aspekt der traumatischen Situation (=
Erkenntnis,
Fähigkeit) |
| C |
eine positive Situation, in der der positive
Aspekt
vom Patienten / der Patientin optimal angewendet werden konnte |
| B' |
eine durch die therapeutischen Interventionen
(5a-m) veränderte
Imagination (= "retroaktive Halluzination" nach Bernheim) |
| KG' |
KG´= das mit der veränderten Erinnerung einhergehende
neue (neutrale/positive) Körpergefühl |
D: Die Fragwürdigkeit von erinnerten Traumata
In den letzten Jahren wurde das Problem des False-Memory-Syndroms (FMS)
vor allem in den USA diskutiert und dessen juristische Relevanz in vielen
Prozessen herausgestellt. Sicherlich existiert dieses Phänomen, denn man
kennt aus der Arbeit mit hypnotischen Techniken ein verwandtes, das der
Pseudoerinnerungen in der Zeit (Orne 1979, Klein u. Guze 1951) oder auch
retroaktiven Halluzinationen genannt (Bernheim 1888). Es ist sehr
wahrscheinlich, daß Pseudeoerinnerungen Folgeeffekte von
Alltagstrancezuständen sind. Viele Praktiker berufen sich leider immer
noch auf die sogenannte Videorecordertheorie des Gedächtnisses (Penfield &
Roberts 1977) obwohl diese schon lange nicht mehr dem Stand der
wissenschaftlichen Erkenntnisse entspricht. So stellt der Amerikaner John
Kotre (1996) in seinem inzwischen übersetzten Buch Weiße Handschuhe
die dazu vorliegenden Forschungen und seine sehr differenzierte
theoretische Sicht von Gedächtnis- und Erinnerungsprozessen dar: von
Verdrängung und Neuinterpretationen, von suggerierten und falschen
Erinnerungen.
In der Praxis sollten diese Phänomene nicht übersehen werden - vor allem
wenn juristische Konsequenzen erwogen werden oder nötig werden sollten.
Therapeutisch allerdings ist eine solche Erinnerung genauso ernst zu
nehmen, wie z.B. Alpträume, die seelisch genauso belastend sein können,
wie "reale" Erinnerungen. Auch diese sind mit der hier beschriebenen
Methode behandelbar. Es ist ja auch nicht die Vergangenheit selbst, die
aktuell Probleme verursacht. Die Vergangenheit hat keine Wirkung mehr,
denn sie ist vorbei. Es ist die Erinnerung an die Vergangenheit, die
störend wirken kann. Wenn diese Erinnerung nun im Laufe der Jahre
Veränderungen erfahren hat, was sehr wahrscheinlich ist, so können diese
Veränderungen negativer oder positiver Natur sein. Entsprechend ist dann
auch der Grad an notwendiger therapeutischer Hilfe unterschiedlich.
|